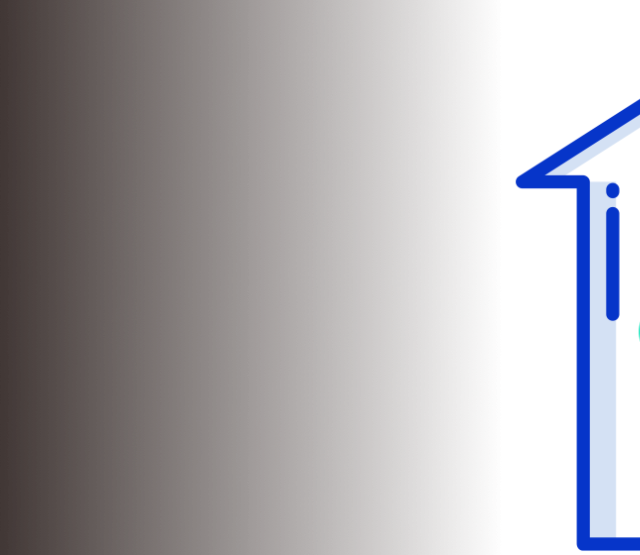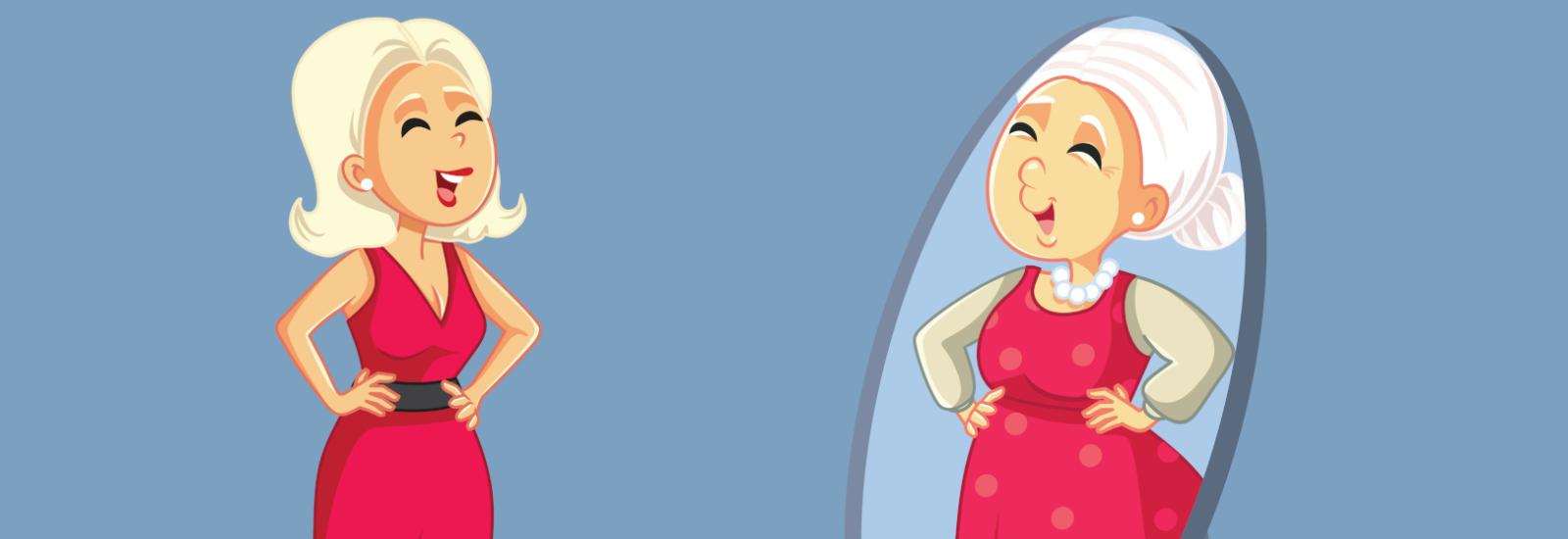
Förderjahr 2023 / Stipendien Call #18 / ProjektID: 6727 / Projekt: Gutes Wohnen in Smart Homes.
Was bedeutet es für das Wohnen, wenn Möbel wie der Persuasive Mirror[2] unser Verhalten beeinflussen, indem sie ein gealtertes Spiegelbild basierend auf ungesundem Lebensstil zeigen und so zu Verhaltensänderungen wie einem gesünderen Leben anregen?
Was bedeutet ein persusives Möbelstück im Kontext des Wohnens wirklich?
Der Spiegel ist wie kein anderes Möbelstück mit Begriffen wie ‚Reflexion‘, ‚Illusion‘, ‚Raumerweiterung‘ und ‚Andersort‘ (die Welt hinter dem Spiegel) verbunden. In der Architektur wird und wurde er wegen den ersten drei Eigenschaften gezielt eingesetzt. Ein berühmte Beispiele ist der Spiegelsaal in Versailles, Paris. Neben den ästhetischen Aspekten gibt es auch philosophische Betrachtungen. Beispielsweise versteht Foucault unter der Utopie des Spiegels einen Ort ohne Ort, der den Betrachter sich selbst erblicken lässt, wo er abwesend ist. [1] Um die Frage nach normativen Nebenwirkungen von intelligenten Spiegeln beantworten zu können benötigt es ein tieferes Verständnis über den Kontext des Spiegels. Dieser ist nicht nur ein unabhängiges (technisches) Artefakt, sondern ein interaktives technisches Artefakt eingebettet und vernetzt im Kontext des Wohnens.
Entwicklung von normativen Sphären
Der tägliche „Blick in die Zukunft“ fordert den Betrachter zu einer momentanen Beurteilung seines Lebenswandels auf. Er wird durch das in die Zukunft interpolierte Spiegelbild mit seinem zukünftigen Erscheinungsbild konfrontiert. Durch das bildgebende Medium werden nicht nur der bewusste Verstand angesprochen, sondern auch unbewusste Emotionen, Denk- und Verhaltensmuster getriggert. Es erfolgt noch vor irgendeiner bewussten normativen Bewertung eine unterbewusste psycho-physische Reaktion, die sich in leiblicher Erregung und affektiver Betroffenheit[3] äußert und sich über eine Gefühlssphäre räumlich ergießt. Je nach subjektiver Befindlichkeit des Betrachters wird die Situation als un- oder angenehmen erlebt. Der Blick in den Spiegel wird zu einem täglichen Prüfungsritual (Abgleich von IST und SOLL). Der Spiegel verändert sich in seiner Bedeutung. Er stellt in der Wohnumgebung nicht mehr nur ein Möbelstück dar, das innenarchitektonisch (optische Raumvergrößerung) oder funktional (Gestaltung der eigenen äußeren Erscheinung Make-up, Kleidung etc.) zum Einsatz kommt, sondern einen Gegenstand von Prophetie. Die aufgebaute Prüfungssphäre kann, je nach Bewertung zu einer aufwärts oder Abwärtsspirale im Verhalten des Bewohners führen. Sie kann, wie von den Entwicklern beabsichtigt, einen gesünderen Lebensstil motivieren. Vermutlich würden hierdurch positive Gefühlsräume manifestiert, die aufgrund emotionaler und mentaler Reaktionen wie Stolz, Freude, „schön sein“ etc. entstehen. Der „Augenblick der zukünftigen Wahrheit“ kann aber auch zu einer negativen Bewertung führen, die von Gefühlen wie Versagen, Sinnlosigkeit, Ohnmacht, Ärger, Wut, Trauer etc. begleitet sein können. Der Nebeneffekt ist eine permanente „habt acht Haltung“ in der jede Handlung, jeder Kontakt mit dem Mobiliar unbewusste Reaktionen und bewusste Bewertungen nach sich zieht. Der Betrachter kann sich der automatischen Eigenbewertung aufgrund seiner menschlichen Konstitution kaum bis gar nicht entziehen. Die mehrmals tägliche Aktivierung von positiven oder negativen Bewertungsreaktionen führt zu einem motivierenden oder demotivierenden Wohnumfeld. Um dies zu verhindern, bedürfte es eine rationale Auseinandersetzung und permanentes Bewusstsein darüber, was der Spiegel abbildet, nämlich das Ergebnis einer Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Basis der ihm zur Verfügung stehender Daten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bewohner ein solch hohes Niveau an dauerhafter bewusster Reflexion innerhalb des „Ge-wohn-ten“ aufrechterhalten ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Bewohner sich an die Prüfungssituation gewöhnen und die beschriebenen aufwärts oder abwärts Spiralen sich automatisch ereignen und somit das Wohnmilieu prägen.
Nebenwirkungen von intelligenten Möbeln
Die Nebenwirkung von ubiquitären Systemen bzw. ambient intelligences, die sich aus einem ganzen Netzwerk von Sensoren, smarten Geräten und KI-Management zusammensetzten, ist die Erschaffung einer multidimensionalen Normativität. Im Kontext des Wohnens entstehen somit durch die Summe von „1+x“ Entitäten ein höchst komplexes, persuasives, mit den Bewohnern verwobenes, nahezu untrennbares Wohnmilieu. Zum einen bietet uns die smarte Umgebung eine höhere Sicherheit und Effektivität der Gebäude, sie erleichtert den Alltag und ermöglichen ein komfortables Leben; zum anderen bildet sich auf materielle-physischer, hermeneutischer und atmosphärischer Ebene eine Moralität des Wohnens aus, das uns zunehmend beeinflusst. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sollten nicht nur von Ethikern in der Theorie bedacht werden, sondern auch in der Praxis.
[3] Darunter ist eine unwillkürliche situative Reaktion zu verstehen die auf leiblicher und emotionaler Ebene stattfindet beispielweise das Gefühl von Scham, dass mit einem leiblichen Gefühl der Enge einhergeht.
Literatur
[1] Foucault M. Andere Räume. In: Defert D., Ewald F. Schriften in vier Bänden, Frankfurt am Main: Suhrkamp; 2005, 931–943.
[2] Pachet F. The future of content is in ourselves. Computers in Entertainment. 2008; 6: 1–20.
Theres-Antonia Bock

Derzeit konzentriere ich mich auf meine Dissertation im Bereich Digitalisierung des Wohnens.
Als Innenarchitektin durfte ich in den letzten Jahren miterleben, wie die Digitalisierung immer mehr in den Standard Wohnbau Einzug hält. Smart Buildings und Smart Homes ermöglichen eine effizienteres Facility-Management. Aus ökonomischer Perspektive macht es daher Sinn diese Technik voranzutreiben. Wie sieht es allerdings mit anderen Bereichen aus, die diese Technik ebenfalls beeinfluss? Mit dem Einzug der smarten Technologien in den Pflegebereich und damit in das assistive Wohnen stellen sich grundlegende ethische Fragen. Im Zuge meines Philosophiestudiums und späteren Forschung beschäftigte ich mich immer mehr mit dem Zusammenhang zwischen Technik- Mensch und dem Wohnen und stellte mir immer mehr die Frage, wie die Digitalisierung des Wohnens unser Verständnis vom Wohnen verändern wird.
Wird es ein gutes Wohnen bzw. Leben sein, wenn wir in Zukunft mit unserem Wohnraum kommunizieren?
Wird es ein gutes Wohnen bzw. Leben sein, wenn unser Wohnraum eine auf uns zugeschnittenes Wohnklima schafft?
Wird es ein gutes Wohnen bzw. Leben sein, wenn uns unser Wohnraum vollautomatisch alle unsere Bedürfnisse stillt?
Wie würde uns das als Menschen verändern? Wären wir noch in der Lage selbst Entscheidungen zu treffen? Wären wir noch in der Lage selbst zu wissen, was uns gut tut? Wären wir noch in der Lage für uns Verantwortung zu übernehmen?